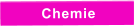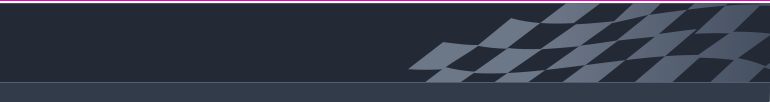
Q1/ Q2 Chemie Gk 2015

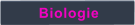
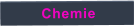
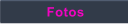

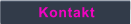

Website Antje Nemetschek

Q1 (1):Analytische Verfahren zur Konzentrationsbestimmung
1
Analytik
1.1
Quantitative Analytik (u.a. Konzentration c, Massenanteil w, Volumenanteil φ, Massenkonzentration β)
1.2
Qualitative Analytik (Nachweisreaktionen)
2
Basiswissen zu Analytik aus der 11
2.1
Das chemische Gleichgewicht
2.2
Die Charakterisierung der Gleichgewichtslage über das MWG bzw. K
2.3
Beeinflussung des chem. GG: Prinzip von le Chatelier
3
Chemie der wässrigen Lösung
3.1
Der Lösungsvorgang (Hydratation): Keine chemische Reaktion!
3.2
Wasserstoffbrückenbindungen (Cluster, Oberflächenspannung)
3.4
Autoprotolyse des Wassers (Wasser als Reagens)
4
Säure-Base-Reaktionen
4.1
Typische Reaktion von Säuren: Protolysen
4.2 Def. Säuren / Basen nach Brönsted
4.3
Warum Protolyse? Mesomerie-Stabilisierung der Säure-Anionen
4.4
Neutralisation
4.5
Qualitative Erfassung der Säure-Stärke: pH-Wert-Berechnungen
4.5.1 pH-Wert Anzeiger: Indikatoren
4.6
Quantitative Erfassung der Säure-Stärke (Kw-, Ks-Wert)
4.7
Löslichkeit von Stoffen und Löslichkeitsprodukt L („KL“)
5
Instrumentelle Analytik
5.1
Säure-Base-Titrationen
5.2
Titrationskurven
Q1 (2): Gewinnung, Speicherung und Nutzung elektrischer Energie
in der Chemie
1
Grundlagen Elektrochemie
1.1
Aufbau und Eigenschaften von Metallen
1.2
Praxis: Experimentell ermittelte Redoxreihe (Metalle oxidieren unterschiedlich gut)
1.3
Elektrochemische Fachbegriffe
1.4
Edle und unedle Metalle (Reaktivität von Metallen gegenüber dem Redoxpaar H2/ 2 H+)
1.5
Lösungstension von Metallen (Ursache für unterschiedlich gute Oxidierbarkeit)
1.6
Praxis: Reinigung von Silber
2
Stromgewinnung aus Redoxreaktionen
2.1
Das Daniell-Element
2.2
Aufbau, Funktion und Diagrammschreibweise galvanischer Elemente
2.3
Praxis: Messung von Potentialdifferenzen Spannungsreihe
2.4
Additivität von Potentialdifferenzen
2.5
Standard-Elektrodenpotentiale (Bezugselement: Wasserstoffhalbzelle)

3
Abhängigkeiten des Elektrodenpotentials
3.1
Praxis Konzentrationszellen (ohne Berechnung)
4
Nutzung Elektrischer Energie: Batterien und Akkumulatoren
4.1
Definition von Primär- und Sekundärelementen
4.2
Leclanché-Batterie
4.3
Grundprinzip und Funktionsweise
4.4
Batteriespannungen in der Praxis
5
Erzwungene Redoxreaktionen: Elektrolyse
5.1
Grundprinzip und Funktionsweise
5.2
Forschung: Stromgewinnung mit der Brennstoffzelle
5.3 Faraday-Gesetzte (Stoffmengenumsatz bei Elektrolysen)
Q1 (3):Reaktionswege zur Herstellung von Stoffen
in der organischen Chemie
1
Wdhl.: Ordnung in der Unordnung
1.1
Forschungsbereiche der Chemie (AC / OC / PC und angewandte Wissenschaften versus
Grundlagenforschung)
1.2
Systematik in der Vielfalt organischer Verbindungen (Stoffklassen, funktionelle Gruppen)
1.3
Systematische Nomenklatur organischer Verbindungen nach IUPAC
1.4
Isomere
2
Vom Erdöl zum Plexiglas: Verknüpfung von Reaktionen zu Reaktionswegen
2.1
Einteilung des Synthesewegs in verschiedene Reaktionstypen
2.2 Substitutionsreaktionen
2.2.1
Radikalische Substitution (Photochemische Halogenierung) (1)
2.2.2
Ungleiche Produktverteilung bei Halogenierungen: Selektivität
2.2.3
Nucleophile Substitution (Halogenalkan Alkohol) (3)
2.2.3.1
Die nucleophile Substitution kann zwei unterschiedlichen kinetischen Gesetzen erfolgen
(SN1, SN2)
2.2.3.2
Beeinflussende Faktoren für nucleophile Substitutionen
2.3.3.3
Exkurs: „Silicone: Alleskönner unter den Werkstoffen“
2.3 Additionsreaktionen (2),(5)
2.3.1
Halogenalkane auch ohne Licht
2.4
Hydrolyse (Wasser rein...) (6)
2.4.1
Exkurs: Seifen / Tenside
2.5 Eliminierung (Wasser raus...) (7)
2.6 Polymerisation von MMA (9)
Q2: Farbstoffe, Farbigkeit & Aromatizität
1
Physik der Farbigkeit
1.1
Das Spektrum der elektromagnetischen Strahlung
1.2
Prismen-Versuche: Farbstoffe absorbieren ihre Komplementärfarbe
1.3
Fotometer und Lambert-Beersche Gesetz (Berechnung der Extinktion)
1.4
Praxis: Bols Blue-Konzentrationsbestimmung
1.5
Wohin geht die Lichtenergie bei der Absorption? (Fuoreszenz /
Phosphoreszenz / Farbigkeit)
2
Orbitalmodell
2.1
Das Orbitalmodell: Atomaufbau neu verstanden
2.2
Bindigkeit nach dem Orbitalmodell
2.2.1
Die Besonderheit: Hybridzustände der C-Atomorbitale (sp, sp2, sp3)
und ihre räumliche Struktur
2.3
Vom Atom zum Molekül (Überlappungen von AOs führen zu MOs)
2.4
Die Symmetrie machts: σ- und π- Bindungen
3
Chemie der farbigen Moleküle
3.1
Strukturmerkmale: Konjugierte Doppelbindungen, Aromaten
3.2
Das System konjugierter Doppelbindungen
3.2.1
Mesomerie
3.2.2
Anzahl der DB bestimmt die Absorption der Wellenlänge
3.2.3
HOMO-LUMO-Konzept
3.3
Farbverschiebungen durch Substituenten: Induktive und mesomere Effekte
4
Aromaten
4.1
Steckbrief des Benzols
4.2
Struktur des aromatischen Systems (konjugierte DB., Mesomerie, Hückelregel)
4.3
Aromatizität nach dem Orbitalmodell
4.4
Die elektrophile Substitution (Bildung des Elektrophils, Katalysator, σ- und π- Komplex,
Rückbildung des aromatischen Systems)
4.5
Derivate des Benzols (v.a. Phenol und Anilin)
4.6
Die Zweitsubstitution (aktivierender + dirigierender Einfluss von Substituenten)
5
Farbstoffklassen
5.1
Indigofarbstoffe
5.2
Azofarbstoffe
5.3
Triphenylmethanfarbstoffe
5.4
ggf. Applied Science (Fotografie, Färbeverfahren)